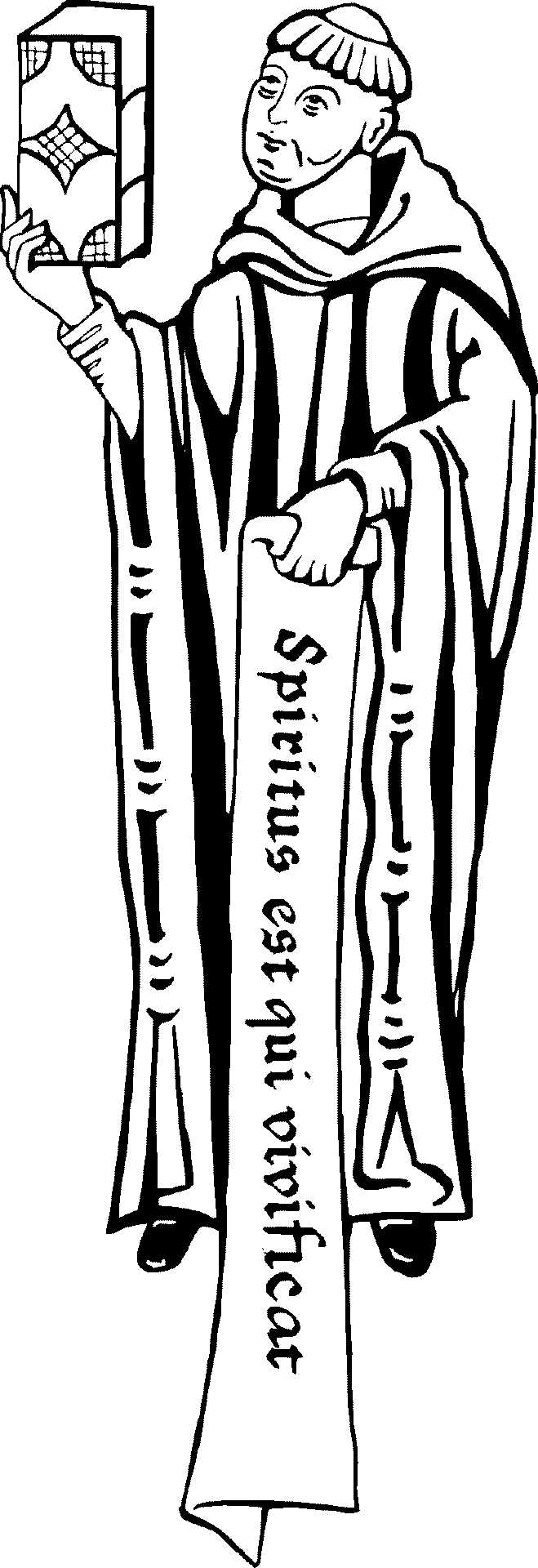Eugen Biser
Prof. Dr.Dr. h.c.mult. Eugen Biser und Ottobeuren
"Spiritus est, qui vivificat."
Eugen Biser und die Ottobeurer Studienwoche
von Pater Johannes Schaber OSB
(Dieser Artikel wurde erstmals veröffentlicht in: Erwin Möde - Felix Unger - Karl Matthäus Woschitz (Hrsg.): An-Denken. Festgabe für E. Biser. Graz-Wien-Köln 1998, S. 75-89.)
Eugen Biser ist der Ottobeurer Studienwoche seit beinahe 25
Jahren als gefragter Referent und später als geschätztes Mitglied des
wissenschaftlichen Gremiums, das die jährliche Tagung thematisch vorbereitet,
engstens verbunden. Abt Vitalis Altthaler OSB und der ganze Konvent von
Ottobeuren gratulieren dem Jubilar Prof. DDr. Eugen Biser von Herzen zu seinem
80. Geburtstag, voll Dankbarkeit für seine große Verbundenheit mit unserer
Abtei.
Die Ottobeurer Studienwoche wird ins Leben gerufen
Seit ihrer Gründung im Jahre 764 n. Chr. verstand sich die Benediktinerabtei St.
Alexander und Theodor zu Ottobeuren über alle Jahrhunderte hinweg als ein
munimentum religioni, als ein Bollwerk des Glaubens. In den Jubeljahren 1764-66
sah sich der Konvent in der glücklichen Lage, sich zur Tausendjahrfeier des
Klosters selbst zu beschenken: Die Jubiläumsgabe war die neue barocke Kirche als
Siegel auf die tausendjährige Vergangenheit und als Auftakt für die Zukunft.
Am 30.IX.1766, dem Tag nach der feierlichen Kirchweihe, bestieg der greise Pater
Aemilian Taenzel von Tratzberg, Kapitular und Bibliothekar der Fürstabtei
Kempten, vor zahlreichem Kirchenvolk die Kanzel und predigte über den Psalmvers
90 (89), 4: Mille anni ante oculos tuos tamquam dies aeterna, quae praeterit.
Immer wieder betonte er, daß Ottobeuren dank der Güte Gottes zwar der Zeit nach
sehr alt sei, seiner geistigen Blüte nach jedoch jung und lebendig. Worin liegt
nun das Geheimnis, daß ein Kloster trotz seines hohen Alters dennoch jung und
lebendig bleibt? Diese Frage stellt sich zunehmend auch und gerade am Ende
unseres Jahrhunderts.
Vor einiger Zeit schilderte Prof. Dr. Hansmartin Schwarzmaier seine Erinnerungen
an das große Jubiläum in Ottobeuren von 1964, das er als junger Historiker
miterlebt hatte: "Vor 30 Jahren, im Sommer 1964, gedachte man in Ottobeuren der
zwölfhundertsten Wiederkehr der Klostergründung. Anders als in Ellwangen und
Lorsch, die auf das gleiche Alter zurückblickten, geschah dies in einer intakten
Benediktinerabtei im Bewußtsein einer - trotz der Säkularisation des Jahres 1802
- ungebrochenen Tradition." Die zahlreichen Redner bei den Feierlichkeiten
unterstrichen allesamt das Wissen um die Wirkungskraft der Geschichte in der
Gegenwart und würdigten ausnahmslos die 1200jährige Kontinuität in Ottobeuren.
Doch Jubiläen bergen auch eine gewisse Gefahr in sich: Wer nämlich nur in die
Vergangenheit sieht oder nicht vergessen kann, wer sich zu sehr in der
Erinnerung ergeht und nicht mehr die Gegenwart gestaltet, der verliert die
Zukunft aus den Augen: "Der Blick wendet sich in die gute alte Zeit zurück. Es
ist die Zeit der Jubiläen. Nach den Visionen fängt dann die Verbindlichkeit der
Gemeinschaft an zu schwinden."
Visionen hingegen fördern die Lebendigkeit, Visionen eröffnen neue Horizonte,
Visionen sind der Raum, in dem kräftiges Leben gedeihen kann. Von Friedrich
Nietzsche lernen wir, daß "jedes Lebendige [...] nur innerhalb eines Horizontes
gesund, stark und fruchtbar werden [kann, JS]; ist es unvermögend, einen
Horizont um sich zu ziehen, und zu selbstisch wiederum, innerhalb eines fremden
den eignen Blick einzuschließen, so siecht es matt oder überhastig zu zeitigem
Untergang dahin. Die Heiterkeit, das gute Gewissen, die frohe Tat, das Vertrauen
auf das Kommende - alles das hängt, bei dem einzelnen wie bei dem Volke, davon
ab, daß es eine Linie gibt, die das Übersehbare, Helle von dem Unaufhellbaren
und Dunkeln scheidet; davon, daß man ebensogut zur rechten Zeit zu vergessen
weiß, als man sich zur rechten Zeit erinnert." 1964 war für Ottobeuren die
rechte Zeit sich zu erinnern. Ähnlich wie schon das Jahr 1764 kennt auch dieses
Jubeljahr eine Jubiläumsgabe: die Ottobeurer Studienwoche: "Die Jubiläumsfeiern
im Jahre 1964 und die erste Studienwoche waren in der zeitlichen Abfolge kaum
ein Zufall, sondern eher ein Teil einer inneren Entwicklung; der Glanz
verlangte, dass man ihn mit Leben erfülle."
Noch blickte die ganze Welt nach Rom und verfolgte die Ereignisse des II.
Vatikanischen Konzils, als man in Ottobeuren der Gründung des Klosters vor 1200
Jahren gedachte.
Anläßlich eines Dies Academicus am 05.VII.1964 forderte der Referent der
Hochschulabteilung im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus,
Ministerialrat Dr. Franz Treppesch, im Kaisersaal der Abtei die Benediktiner
allgemein auf, für die akademische Jugend intensiver tätig zu werden: "Die
Benediktiner, die ein so reiches Erbe verwalten, sollten an dieser Stätte
Hochschulwochen abhalten. Tradition wird museal, wenn sie nur um ihrer selbst
willen da ist; Tradition hat soviel Wert, als sie in die Gegenwart und Zukunft
hereinwirkt. So käme es zu einer Begegnung von benediktinischem Geist und
benediktinischer Welt mit der akademischen Jugend, zum Segen und zum Frieden der
Welt und es würde mitgewirkt, daß dieses ora et labora wieder jene Synthese
findet, in der die Welt heil werden kann."
Genau eine Woche später, am Alexanderfest, fand ebenfalls im Kaisersaal in
Gegenwart von Abtprimas Dr. Benno Gut OSB und Prof. Dr. Augustin Mayer OSB, dem
Rektor von S. Anselmo in Rom, eine Festversammlung der Bayerischen
Benediktinerakademie [BBA] statt. Der Ottobeurer Stiftsarchivar und
Verantwortliche für die Jubiläumsfeierlichkeiten, Pater Aegidius Kolb OSB, regte
hierbei die Möglichkeit an, daß doch die BBA als Basis einer Studienwoche in
Ottobeuren tätig werden könnte. Diese lehnte jedoch auf ihrer Vollversammlung am
30.X.1964 mit dem Hinweis ab, solch öffentliche Tätigkeit entspreche nicht der
Aufgabe und dem Wesen der BBA. Trotz allem hielt Pater Aegidius Kolb OSB an der
Idee von Studienwochen fest und fand im März 1965 in Herrn Regierungsbaumeister
Willy Hornung einen wichtigen und tatkräftigen Mitstreiter. Die Ergebnisse ihrer
Gespräche trugen sie sogleich dem Abt von Ottobeuren, Herrn Abt Vitalis Maier
OSB (*1912, Abt 1948, +1986), vor, der sich begeistern ließ und P. Aegidius nur
kurze Zeit später beauftragte, die Vorarbeiten und Planungen weiterzutreiben.
Nachdem P. Aegidius am 18.VI.1965 seinen Freund Prälat Prof. Dr. Johannes Duft,
den St. Galler Stiftsbibliothekar, zur Mitarbeit gewinnen konnte, entstand ein
erster Vorentwurf für die Ottobeurer Studienwochen: "In Fortführung der
1200-Jahr-Feier der Abtei Ottobeuren bietet sich die Aufgabe an, weiterhin eine
Basis geistig-kultureller Wirksamkeit zu sein. Um der akademischen Jugend, die
guten Willens ist, neben dem einseitigen Fachstudium auch die Möglichkeit einer
religiös-weltanschaulichen Orientierung zu bieten, ist Ottobeuren der ideale
Rahmen einer akademischen Studienwoche." Die Initiatoren wünschten sich, daß im
Mittelpunkt dieser Studienwochen immer aktuelle Aspekte stehen sollten, die sich
aus dem Spannungsverhältnis zwischen Glaube, Christentum und Kirche einerseits,
sowie Welt und pluralistischer Gesellschaft andererseits ergeben. Deshalb wurde
als Motto für die Studienwoche der programmatische Satz aus dem Evangelium nach
Johannes gewählt: Spiritus est, qui vivificat (Joh 6, 63).
Das Emblem der Studienwoche, das auf allen Plakaten, Programmen und
Ankündigungen zu sehen ist, stellt den Mönch Reinfried von Ottobeuren nach einer
alten Handschrift des 12. Jahrhunderts dar. Ihm verdanken wir die größte Anzahl
der wertvollen Prunk-Handschriften aus dem hochmittelalterlichen Ottobeuren. Der
Text auf der Schriftrolle, die er in seiner linken Hand hält, wurde für die
Studienwoche abgeändert und bekundet nunmehr ihr Motto.
Neben der ungewissen Finanzierung bestand eine weitere hohe Hürde bei der
Gründung der Studienwoche, nämlich ein Gremium namhafter Wissenschaftler zu
bestellen, das die alljährlichen Studienwochen thematisch vorbereitet. Am
04.VII.1965 bat P. Aegidius seinen Freund Johannes Duft, Herrn Professor Karl
Rahner SJ in München anzuschreiben und ihn für das wissenschaftliche Gremium der
Studienwoche zu gewinnen. Schon am 30.VII.1965 kam der Antwortbrief von Johannes
Duft an P. Aegidius, in dem er ausführlich die Antwort von Karl Rahners
Assistenten Dr. Karl Lehmann zitiert: "Prof. Rahner ist im Augenblick verhindert
und dankt Ihnen vorläufig einmal für die Unterlagen der 'Ottobeurer
Studienwoche'. [...] Prof. Rahner möchte noch weitere Einzelheiten der
Grundausrichtung einer solchen Studienwoche besprechen, weil er vor allem aus
einer solchen Studienwoche eine eigenständige Sache erwachsen lassen möchte, die
nicht einfach das Vorbild der katholischen Akademien, der Salzburger
Hochschulwochen u.a. kopiert. In diesem Sinne werden wohl noch einige Gespräche
nötig sein. Grundsätzlich aber ist Prof. Rahner zu einer Mitarbeit im
'wissenschaftlichen Gremium' bereit."
Auch der zur Mitarbeit im Gremium eingeladene Direktor des Kanonistischen
Seminars der Universität Freiburg i.Br., Prof. Dr. Ulrich Mosiek wirft in seinem
Antwortschreiben vom 12.XII.1965 ein wichtiges Licht auf die Zielsetzung der
Arbeit im Gremium: "Den Vorentwurf der Ottobeurer Studienwoche habe ich mit
Interesse gelesen und ich sehe in der gestellten Aufgabe eine lohnende Arbeit,
zumal es jetzt nach Beendigung des Konzils unsere Aufgabe sein muß, die dort
gefaßten Beschlüsse besonders unseren Akademikern nahezubringen."
Einige weitere Wunschkandidaten wurden zwischen Juli und Dezember 1965
angeschrieben und zur Gründungssitzung am 18./19.XII.1965 in das "Hotel
Europäischer Hof" nach München eingeladen. Anwesend waren insgesamt acht
Universitätsprofessoren, die Initiatoren: Ministerialrat Dr. Franz Treppesch, P.
Aegidius Kolb OSB, Regierungsbaumeister Willy Hornung und Abt Vitalis Maier OSB
sowie als geistlicher Begleiter für die Studienwoche Abt-Koadjutor Dr. Odilo
Lechner OSB aus München. Verhindert, aber zur Mitarbeit im Gremium grundsätzlich
bereit waren noch fünf weitere Professoren. Für 1966 wurde als erstes
Jahresthema gewählt: Kirche und pluralistische Gesellschaft.
Die erste Ottobeurer Studienwoche 1966
Karl Rahner SJ erklärte sich bereit, die Eröffnungsvorlesung zum Thema
Selbstverständnis der Kirche vorzutragen. Die anderen Themen wurden zwar vom
wissenschaftlichen Gremium inhaltlich abgesteckt, doch man benannte noch keine
dafür in Frage kommenden Referenten. Die Einladung geeigneter Referenten
übernahm eine kleine Gruppe, die sich am 29.I.1966 traf. Nach der
Terminabsprache mit Prof. Dr. Franz-Martin Schmölz OP schrieb Ministerialrat Dr.
Treppesch am 24.I.1966 an P. Aegidius Kolb OSB: "Ich würde doch empfehlen, wir
setzen uns Samstag, den 29.I. vormittags mit Schmölz und Lehmann in meinem
Geschäftszimmer im Ministerium zusammen und besprechen die Redner durch." Am
Ende konnten Prof. Dr. Heinz-Robert Schlette (Bonn): Christen und Nichtchristen
in heutiger Gesellschaft; Prof. Dr. Hans Maier (München): Verhältnis der Kirche
zum Staat; und Prof. Dr. Ernst Wolfgang Böckenförde (Heidelberg):
Religionsfreiheit gewonnen werden. Die Vorträge fanden unter Leitung von Prof.
Dr. Max Roesle OSB aus Salzburg vom 26.-29.VII. 1966 im barocken Bibliothekssaal
statt und wurden durch eine Exkursion am 30.VII. ins ehemalige Fürststift
Kempten und zum Schloß Wolfegg abgerundet. Die täglichen Eucharistiefeiern mit
Ansprache hielt Abt Dr. Odilo Lechner OSB von St. Bonifaz in München. Insgesamt
nahmen 38 Studenten und 10 Akademiker aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz teil. Dies war ein großer Erfolg für die erste Studienwoche; der barocke
Glanz Ottobeurens wurde mit neuem Leben erfüllt.
Zehn Jahre später lud das Gremiumsmitglied Prof. Dr. Carl Pfaff Herrn Prof. DDr.
Karl Lehmann zu einem Vortrag ein, der ihm daraufhin am 22.I.1976 aus Freiburg
i.Br. antwortete: "Leider kann ich die freundliche Einladung nach Ottobeuren
nicht annehmen [...]. Es tut mir sehr leid, zumal ich an der Seite von Karl
Rahner die Geburtsstunden der Ottobeurer Studienwochen miterfahren und auch ein
bißchen mitgetragen habe." Und 25 Jahre später erinnert sich Lic. iur. Peter
Fischer (Solothurn) an die Anfänge zurück: "So ist auch ein persönlicher Kontakt
möglich, sei es bei den gemeinsamen Mahlzeiten oder abends im Wirtshaus. Aus
solcher Nähe werden dann auch professorale Vorlieben und Marotten sichtbar: Karl
Rahner musste, hohe Theologie hin oder her, am Fernsehen die Fussballspiele der
Weltmeisterschafts-Endrunde sehen. Hans Maier hatte den Mut, uns ausserhalb
rechtlicher Ueberlegungen über Kirche und Staat ein Orgelkonzert darzubieten."
Den Mitgliedern des wissenschaftlichen Gremiums konnte auf der zweiten
Gremiumssitzung am 17./18.XII.1966 von einem großen Erfolg und einem guten
Anfang berichtet werden, der zu vielversprechenden Hoffnungen Anlaß gab.
Eugen Biser und die Ottobeurer Studienwoche
Eugen Bisers erster Kontakt mit der Ottobeurer Studienwoche reicht zurück in das
Jahr 1974, als er von Würzburg nach München wechselte und Nachfolger Karl
Rahners SJ auf dem Lehrstuhl für Christliche Weltanschauung und
Religionsphilosophie wurde. Das Gremiumsmitglied Heinrich Fries erhielt bei der
Sitzung im Dezember 1973 den Auftrag, Eugen Biser für das erste Referat der 9.
Studienwoche im August 1974 zu gewinnen. Schon am 08.I.1974 teilte er dem
Sekretariat mit, daß er Prof. Eugen Biser bereits für das einleitende Referat
gewonnen habe.
Das Jahresthema 1974 lautete: Frieden und Christentum. Prof. Biser, der soeben
sein letztes Würzburger Semester beendet hatte und am Vortag noch durch eine
wichtige Besprechung mit dem Bayerischen Kultusminister Prof. Dr. Hans Maier in
München ganztägig in Anspruch genommen war, referierte als erster am
06.VIII.1974 im barocken Bibliothekssaal der Abtei, zu Füßen der marmorierten
Holzfigur der Pallas Athenae, der Göttin der Weisheit, vor 57 Teilnehmern zum
Thema: "Der Friedensauftrag des Christentums. Umrisse einer Theologie des
Friedens: Die Friedensbotschaft Jesu." Schräg über seinem Rednerpult, an der
Decke unter der Bibliotheksgalerie, ist ein Bild gemalt, auf dem eine
Pfeifenorgel mit dem Spruch intacta silent abgebildet ist: Nur wer kraftvoll in
die Tasten langt, wird Musik hören, die unberührten Tasten nämlich schweigen.
Ganz im Sinne dieser Malerei zog Professor Eugen Biser alle Register seines
immensen Wissens und seines großen Könnens, seiner mitreißenden Beredsamkeit und
seiner barocken Eloquenz. Die drei nachfolgenden Redner hatten es wahrlich nicht
leicht nach einem solchen Auftakt: Prof. Dr. Otto Kimminich (Regensburg):
Christentum, Völkerrecht und Europäische Friedensordnung; Prof. Dr. Hans
Zwiefelhofer SJ (München): Befreiung durch Revolution oder gewaltlosen
Widerstand? Christen in der dritten Welt vor der Versuchung zur Gewaltanwendung?
Dargestellt am Beispiel Lateinamerika; Prof. Dr. Karl Rahner SJ (München):
Konflikte in der Kirche.
Die 15. Ottobeurer Studienwoche im Jubiläumsjahr 1980
Im großen Jubiläumsjahr des hl. Ordensvaters Benedikt 480-1980 wurde für die
Studienwoche als Generalthema gewählt: Das Böse in der Welt, ein wahrhaft
benediktinisches Thema. Vor Eugen Biser, der diesmal das letzte Wort hatte,
referierten vor 76 Teilnehmern die Professoren Dr. Anton Ziegenaus (Augsburg):
Wer ist der Fürst dieser Welt?; Dr. Wilhelm J. Revers (Salzburg): Verblendung
und Hybris und DDr. Hubert Tellenbach (München): Kranksein und das Böse. Eugen
Biser sprach zum Thema: Die vergessene Dimension des Heilen - Erlösung des
ganzen Menschen, das ihn nach eigenen Aussagen jahrzehntelang beschäftigte. In
den Mittelpunkt seines Referats stellte er die Heilserfahrung des Christentums.
Zutiefst bedauerte Biser eine folgenschwere Akzentverschiebung in der Geschichte
der Theologie: Christus ging es nicht in erster Linie um die Erlösung des
Menschen von der Sünde, sondern vielmehr um die Erlösung aus der Unfähigkeit des
Menschen zur Selbstverwirklichung und zur Annahme seiner selbst. Ist der Mensch,
was er sein kann oder ist er nur ein uneingelöstes Versprechen? "Nach Bisers
Auffassung ist es die Aufgabe der heutigen Theologie, der Heilslehre einen
höheren Stellenwert beizumessen. Das Ergebnis des kirchengeschichtlich bedingten
Transformationsprozesses des Evangeliums gelte es zurückzuübersetzen: Christus
richte seine Heilsbotschaft nicht aus der Höhe der Schuldlosigkeit an seine
Gemeinde, sondern erklärte sich mit ihr solidarisch." Heilung meinte
ursprünglich also nicht einfach Erlösung von der Sünde, sondern eine Hilfe dort,
wo die Fähigkeit des Menschen zur Selbstverwirklichung nicht ausreicht. 1995 hat
Eugen Biser diese Überlegungen in einer seine Gedanken zusammenfassenden
Publikation ausführlich dargestellt. Darin formuliert er sein größtes Anliegen:
"Wenn die vorliegende, von jahrzehntelangen Überlegungen unterbaute Präsentation
des konkret existierenden Menschen eine Kurskorrektur veranlassen könnte, hätte
sie ein wichtiges Ziel erreicht."
Eugen Biser und das wissenschaftliche Gremium der Studienwoche
Auf Einladung von Abt Vitalis Maier OSB traf sich am 05./06.XII.1981 das
wissenschaftliche Gremium im Kardinal-Wendel-Haus in der Münchner Mandlstraße 23
zur Vorbereitung der Studienwoche 1983. Anwesend waren nur die Mitglieder: Abt
Vitalis Maier OSB, P. Aegidius Kolb OSB sowie die Professoren Dr. Anton
Ziegenaus (Augsburg), Dr. Wilhelm J. Revers (Salzburg), Dr. Carl Pfaff
(Fribourg), Dr. Franz-Martin Schmölz OP (Salzburg) und DDr. Hermann Eyer
(München).
Wissenschaft und Wirklichkeitserfahrung wurde als Generalthema erarbeit. Für das
erste Thema: "Theologie ohne Religion?" wurde Prof. DDr. Eugen Biser
vorgeschlagen. Franz-Martin Schmölz OP, der wußte, daß sich Eugen Biser zufällig
am selben Abend auch im Kardinal-Wendel-Haus aufhielt, verließ die Sitzung und
ging zu Eugen Biser, um mit ihm sofort zu sprechen. Es gelang ihm dabei nicht
nur, Eugen Bisers Zusage für das Einleitungsreferat der Studienwoche 1983 zu
erhalten, er gewann ihn auch zur Mitarbeit im wissenschaftlichen Gremium. In der
Anwesenheitsliste der Gremiums-Sitzung ist der handschriftliche Vermerk P.
Aegids zu finden: Neues Gremiums-Mitglied: Prof. Eugen Biser. Prof. Dr. Anton
Ziegenaus vermerkte am 24.II.1982 im Protokoll der Gremiumsitzung schlicht:
"Herr Biser hat noch am 5.12.1981 seine Bereitschaft, im Kuratorium mitzuwirken,
erklärt."
In all den Jahren brachte sich Professor Eugen Biser seitdem bei der
Vorbereitung aller Studienwochen bis 1999 mit seiner ganzen Persönlichkeit ein.
Und war er einmal an der Teilnahme bei einer Gremiumssitzung verhindert, so
äußerte er schriftlich oder telefonisch seine Ideen, Vorstellungen oder Anliegen
beim Leiter der Studienwoche.
Die Studienwochen 1983, 1988 und 1991
Die Vorträge, die Eugen Biser auf verschiedenen Studienwochen hielt, waren meist
Themen, die ihn überhaupt sehr beschäftigten. Darum war es ihm jedesmal ein
leichtes, aus dem reichen Fundus seiner Gedanken zu schöpfen. Im
Einleitungsvortrag zur 18. Studienwoche am 02.VIII.1983 beschäftigte sich Biser
mit der Frage: Theologie ohne Religion? Gleich zu Beginn erinnerte er an die
drei großen Jubiläen des Jahres 1983 im Andenken an Richard Wagner, Karl Marx
und Martin Luther. Alle drei hätten gemeinsam, daß ihr Streben nach Totalität in
der Musik, in der Gesellschaft und in der Kirche nur für den hohen Preis der
Aufgabe eines ihrer Wesenszüge gelungen sei. Wagner wollte die perfekte Musik
komponieren, jedoch ohne Form; Marx wollte die perfekte Gesellschaft schaffen,
jedoch ohne den Menschen in seiner Person zu beachten; Luther wollte die
perfekte Reform, jedoch ohne Bindung an die institutionalisierte Kirche. Daran
anknüpfend fragt nun Biser, was eine Theologie ohne Religion sei, wenn sie nicht
einen ihrer Wesenszüge verlieren wolle? Er gliedert seine Ausführungen in die
beiden Teilbereiche: 1. Was ist das noch Christentum ohne Religion? und 2. was
ist eine Theologie noch ohne Gott? In einem kirchengeschichtlichen Rückblick von
Augustinus bis Karl Barth stellte er fest, daß der heute oftmals erhobene
Vorwurf an die Theologie, sie sei religions- und gottlos, auch schon ein
zentraler Vorwurf gegen das Christentum der ersten Stunde gewesen sei. Am
Extrembeispiel der Gott-ist-tot-Theologie erläuterte Biser heutige Versuche
einer Theologie ohne Religion. Die Einführung der historisch-kritischen Methode
im 19. Jahrhundert, in der die Theologie die Methoden der
Geschichtswissenschaft als streng wissenschaftliches Instrument auf sich
anwandte, bewirkte zwar, daß sie im Vergleich zu anderen Wissenschaften
konkurrenzfähig wurde, da jedoch der Bereich der Offenbarung auf einen kleinen
Rest reduziert wurde und der Bezug zur gläubigen Wirklichkeit verlorenging,
büßte diese Art der Theologie doch den wichtigsten ihrer Wesenszüge ein. So fand
Eugen Biser ausführlich Gelegenheit, sein Verständnis von Theologie vor rund 90
Teilnehmern zu entfalten. Nach ihm referierten Prof. DDr. Heinrich Schipperges
(Heidelberg): Medizin ohne Mensch?; Prof. Dr. Marian Heitger (Wien): Pädagogik
ohne Kinder? und Prof. Dr. Wilhelm J. Revers (Salzburg): Psychologie ohne Seele?
Ein weiteres großes Thema Eugen Bisers sollte auf der 23. Studienwoche vom
26.-29.VII.1988 mit ihrem Generalthema Französische Revolution - 200 Jahre
danach folgen, welche die Absicht hatte, die historischen Ereignisse der
Französischen Revolution von 1789 und ihre Nachwirkungen zu bewerten. Unter
Leitung von Prof. Dr. Carl Pfaff referierten Prof. Dr. Erika Weinzierl (Wien):
Die französische Revolution - Ein Schock für die Kirche; Prof. DDr. Eugen Biser
Die Säkularisierung - Das Schicksal der Ideen; Prof. Dr. Franz Furger (Münster):
Die französische Revolution - Inkubationszeit für die Menschlichkeit und Prof.
Dr. Axel Frhr. von Campenhausen (Hannover): Demokratie - Die christliche
Regierungsform?
In einer Zeit, da überkommene Weltbilder fragwürdig und die Grenzen und Folgen
der Wissenschaft immer sichtbarer werden, versucht Eugen Biser eine klare und
überzeugende Richtung anzugeben, indem er in seinem Referat Die Säkularisierung
- das Schicksal der Ideen darauf abhebt, "daß der Säkularisierungsprozeß nicht
nur allgemein religiöse, sondern auch ideelle Positionen ergriffen und zu
tiefgreifenden Transformationen ihrer Inhalte geführt hat. So wurde
beispielsweise der für das Christentum grundlegende Gedanke der Offenbarung zum
Begriff künstlerischer Inspiration, der Freiheitsgedanke zum Motto des
politischen und weltanschaulichen Liberalismus und der Friedensbegriff zu einer
politischen Utopie. Sodann werde ich zu zeigen versuchen, daß heute eine ganze
Reihe von Symptomen auf das insgeheim bereits erreichte Ende des
Säkularisierungsprozesses hindeuten. Damit entsteht die Chance, daß von
Offenbarung, von Freiheit und von Frieden wieder im genuin christlichen Sinne
gesprochen werden kann. Auch läßt sich zeigen, daß diese Begriffe völlig
verflachen, wenn sie nicht an ihren christlichen Ursprung zurückgebunden werden.
Das Versanden der Friedensbewegung und der Ausverkauf der Freiheit im
gegenwärtigen Geistesleben sprechen in diesem Zusammenhang eine
unmißverständliche Sprache. Insofern liegt die Erinnerung an den christlichen
Ursprung im tiefsten Interesse der Gegenwart." Die Grundgedanken seines Vortrags
publizierte Eugen Biser ein Jahr darauf.
Nach dem Fall der Mauer in Deutschland 1989 war das Generalthema der 23.
Studienwoche Die Wiederkehr der Freiheit in Europa von besonderer Aktualität. Es
referierten Prof. Dr. Oskar Köhler (Freiburg): Europa: Wirklichkeit statt
Utopie? Vom christlichen Abendland zum modernen Europa; Wissenschaftsminister
Prof. Dr. Hans Joachim Meyer (Potsdam): Wege statt Mauern. Der geistige
Austausch; Prof. Dr. Hans Maier (München): Gesellschaft - Wirtschaft - Politik.
Wird Europa seine Einheit wiederfinden? und Prof. DDr. Eugen Biser (München):
Einheit und Vielfalt. Die christliche Herausforderung.
Wenige Wochen vor seinem Vortrag bekannte Eugen Biser dem damaligen Leiter der
OStW, P. Thomas Greiter OSB: "Selten hat mich ein Text so sehr beschäftigt wie
der meines Vortrags am 2. August." Eugen Biser fragt sich, wie wohl den
Millionen von Menschen, die sich nicht mehr zum Christentum bekennen, die
Botschaft Jesu neu vermittelt werden könnte? Er wirft der Kirche eine
beschämende Sprachlosigkeit vor, als sie einfach nur zusah, wie die Menschen im
Osten 1989 durch den Fall der Mauer die Freiheit zurückerhielten. Jesus Christus
war es doch, der uns Menschen überhaupt zur Freiheit befreit hat (vgl. Gal 5,1).
Biser hätte es lieber gesehen, daß uns dieses weltgeschichtliche Ereignis in der
Kirche alle erstaunt und ergriffen von den Stühlen gerissen hätte, schließlich
besagt dieses Zeitzeichen "soviel wie das Ende der geteilten Welt, Freiheit für
die bisher Unterdrückten und damit für alle, Aufhebung des Gegensatzes von Ost
und West mit seinen zerstörerischen Folgen, und christlich gesehen, das
Paradigma eines göttlichen Geschichtshandelns und die Kategorie einer neuen
Denkbarkeit von Auferstehung."
Eugen Biser und die Existenzkrise der Ottobeurer Studienwoche 1994
Überraschend und völlig unerwartet schied P. Thomas Greiter OSB, Sekretär der
Studienwoche seit 1984, aus seinem Amt aus. Auf der Gremiumsitzung vom
04.XII.1993, an der Eugen Biser nicht teilnehmen konnte, machte P. Thomas keine
einzige Andeutung. Noch am 21.XII.1993 antwortete er dem Gremiumsmitglied Prof.
Dr. Heinrich Schmidinger (Salzburg) auf dessen Brief vom 15.XII. und verschickte
an einen Referenten, der für die Studienwoche 1994 zugesagt hatte, die
offizielle Einladung.
Abt Vitalis Altthaler OSB (Abt seit 1986) teilte am 05.I.1994 den
Gremiumsmitgliedern das Ausscheiden von P. Thomas und sein Bedauern darüber mit,
daß er keine Möglichkeit sehe, die Studienwoche von Seiten der Abtei
weiterzuführen. Da die Aufgaben der Abtei immer größer und die Zahl der Mönche
immer kleiner würden, übersteige die Studienwoche unter den eingetretenen
Umständen einfach die Kräfte des Konvents. Alle Gremiumsmitglieder waren
zunächst sprachlos über diese Mitteilung, jedoch keinesfalls dazu bereit, die
Studienwoche einfach aufzugeben. Sie sagten Abt Vitalis alle ihre Bereitschaft
zu einer verstärkten Unterstützung zu. Vor allem Eugen Biser bemühte sich nach
Kräften um den Fortbestand der Studienwoche. Er beschwor Abt Vitalis geradezu,
die Studienwoche weiterzuführen und setzte zur tatkräftigen Hilfe viele Hebel in
Bewegung.
Als Abt Vitalis unmittelbar nach seinem Schreiben an die Gremiumsmitglieder auch
dem Konvent mitteilte, daß die Studienwoche aufgegeben werden müsse, erklärten
sich Fr. Johannes Schaber OSB (als Leiter im Vordergrund) und Fr. Tobias Heim
OSB (als Organisator im Hintergrund) bereit, die Studienwoche weiterzuführen.
Damit hatte der Abt nicht gerechnet. Umso größer war seine Freude und die Eugen
Bisers, dem ich die gute Nachricht Ende Januar 1994 nach der sonntäglichen
Abendmesse in der Sakristei von St. Ludwig in München persönlich überbrachte.
Die Durchführung der für 1994 geplanten Studienwoche war zwar nicht mehr
möglich, doch sie konnte auf 1995 verschoben werden: "Informiert und
manipuliert. Der vernetzte Mensch im Medienzeitalter". Um seiner Freude über die
Weiterführung der Studienwoche Ausdruck zu verleihen, reiste Eugen Biser am
04.VIII.1995 zum Vortrag von Herrn Weihbischof Prof. Dr. Peter Henrici SJ
(Chur-Zürich) vor 70 Teilnehmern eigens an.
1996 bekam die 30. Studienwoche dann ein neues Gesicht und ein neues Profil. In
mehreren Gesprächen mit Professor Eugen Biser 1994/95 entwickelte ich ein neues
Konzept für die Studienwoche, das vom Gremium am 30.VI.1995 gutgeheißen wurde.
Wurde bislang großer Wert auf den internationalen Charakter der Studienwoche
gelegt, so sollte fortan der neue Schwerpunkt auf dem regionalen, d.h.
schwäbischen und bayerischen Raum liegen. Um außerdem mehr interessierten
Akademikern die Teilnahme zu erleichtern, wurde nach 30 Jahren der traditionelle
Termin von der ersten Ferienwoche im Sommer auf die Tage von 'Christi
Himmelfahrt' bis zum darauffolgenden Sonntag verschoben.
Bei der 30. Studienwoche 16.-19.V.1996: "Auferstehung oder Reinkarnation? Zur
Aktualität des Osterglaubens" referierten vor 160 Teilnehmern Prof. DDr. Johann
Figl (Wien): Reinkarnation. Ursprüngliches Verständnis und zeitgenössische
Fehlinterpretation; Prof. Dr. Jacob Kremer (Wien): Die biblische Botschaft vom
ewigen Leben; Prof. Dr. Hans Kessler (Frankfurt a.M.): Seelenwanderung oder
ewiges Leben? Grund und Sinn der christlichen Auferstehungshoffnung; und Prof.
DDr. Eugen Biser: Der antwortende Zeuge -- Paulus. Nachdem Eugen Biser schon in
der sonnenüberfluteten Basilika in seiner Sonntagspredigt das Ottobeurer
Gotteshaus mit überschwenglicher Eloquenz und barocker Lebendigkeit erfüllt
hatte, kam er im Vortrag auf den Kronzeugen seines eigenen Denkens zu sprechen:
Paulus. Eugen Biser bezeichnete die Ostererscheinungen als die Grundlage des
Auferstehungsglaubens. Ziehe man alle Ausschmückungen der biblischen Berichte
ab, so blieben schlicht die Aussagen von Zeugen, die nach eigener Aussage dem
auferstandenen Christus begegnet seien. Ihr Zeugnis entzieht sich jedoch jedem
wissenschaftlichen Zugriff, es gehört in den Bereich religiöser Erfahrung.
Paulus, der Christus vor Damaskus begegnete, ist einer der wichtigsten Zeugen
der Auferstehung. Die Dynamik, mit der er und die Jünger die Menschen zu
überzeugen vermochten und Gemeinden gründeten, lassen den Schluß zu, daß es sich
bei ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen nicht um Halluzinationen, sondern um
reale Begegnungen gehandelt habe. Diese ursprüngliche Dynamik fehlt unserem
krisengeschüttelten Glauben heute. Die Suche nach vermeintlichen Alternativen,
wie sie die Reinkarnationslehre bietet, ist ein Symptom dieser Krise. Biser
forderte auf, mündig zu denken und christliche Wahrheiten nicht preiszugeben,
sondern sie neu zu entdecken, und zwar mit demselben Elan und derselben
Phantasie, "wie jene Künstler des Barock, die die herrliche Ottobeurer Basilika
erbauten."
Dieser erfolgreichen Studienwoche schrieb eine Teilnehmerin ins 'Gästebuch':
"Den Eindruck vieler Tagungsteilnehmer möchte ich nochmals bekräftigen:
Ottobeuren ist ein besonderer Ort: mehr Verbindlichkeit, mehr Menschlichkeit,
mehr Humor und mehr Kompetenz als in Akademien üblich." Damit ist es allen, die
ihre Kraft für die Studienwoche einsetzen, wieder einmal mehr gelungen, den
barocken Glanz Ottobeurens mit Leben zu erfüllen und dem Motto der Studienwoche
gerecht zu werden:
Spiritus est qui vivificat.
Eugen Biser hat in 25 Jahren wesentlich zu dieser Lebendigkeit beigetragen. Und
wenn er am 21.V.1998 (Christi Himmelfahrt) bei der 32. Studienwoche zum Thema
"Der inwendige Lehrer. Die Christusmystik" spricht, dann wird er sich selbst in
das Dilemma der Retorsion bringen. Von Retorsion spricht man in der klassischen
Logik, wenn jemand an das, "was er, indem er seine Behauptung aufgestellt hat,
als unerläßliche Bedingung für die Gültigkeit seiner Behauptung als wahr
annehmen mußte, unabhängig davon, ob er es wollte oder nicht," nicht anknüpft.
Eugen Bisers Aussage: "Mit Karl Rahner sank der letzte Theologe ins Grab, der
mehr noch durch seine persönliche Ausstrahlung und das durch ihn verkörpterte
Programm als durch seine wissenschaftliche und literarische Arbeit
bewußtseinsbildend gewirkt hatte", steht im Widerspruch zu seiner eigenen
Lebendigkeit und seinem Engagement am Rednerpult der Studienwoche. Im Vollzug
des Vortragens widerspricht er dem Inhalt seiner eigenen Aussage. Der wirklich
letzte Theologe nämlich, der durch seine persönliche Ausstrahlung und das durch
ihn verkörperte Programm heute noch auf unzählige Menschen wirkt, ist der nun
80jährige Eugen Biser selbst. Ihm zu Ehren findet vom 30. September bis zum 3.
Oktober 2000 die 35. Ottobeurer Studienwoche statt zum Thema: Einweisung ins
Christentum (Eugen Biser zum Kennenlernen).