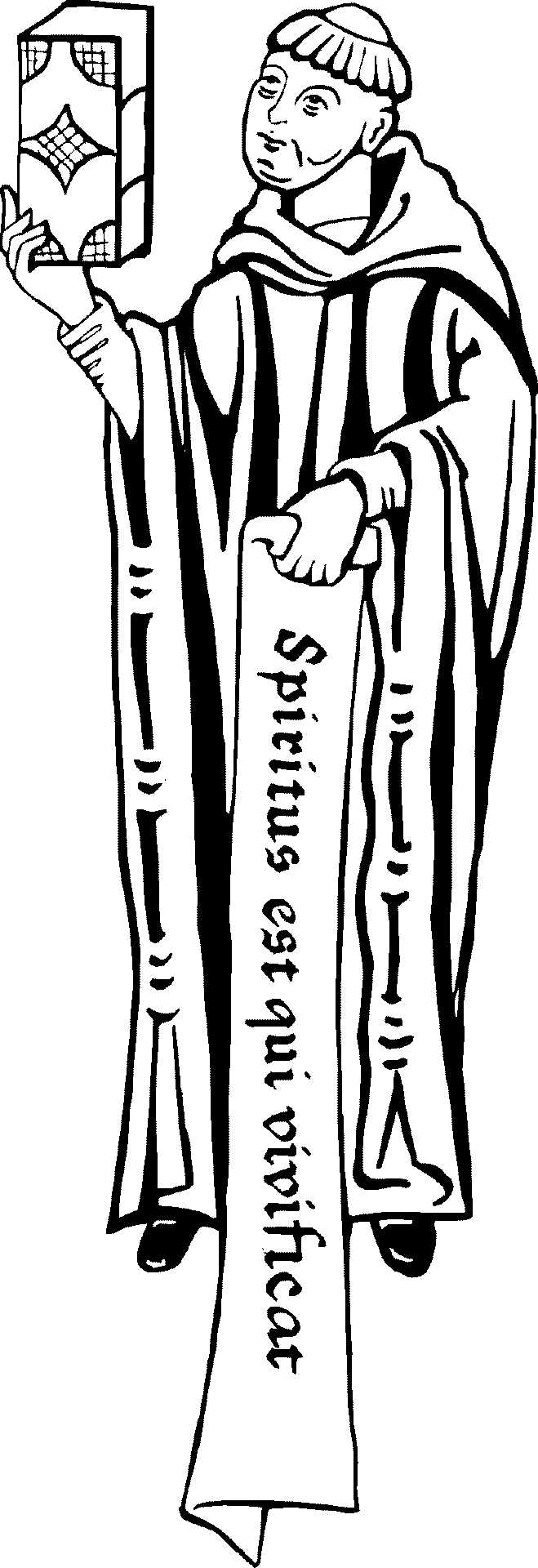Karl Rahner
Prof. Dr.Dr. h.c. mult. Karl Rahner und Ottobeuren
Die Ottobeurer Studienwoche als Forum des kirchlichen Dialogs.
von P. Johannes Schaber OSB (Ottobeuren)
(Der Artikel ist erschienen im:
Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte 32 (1998), 167-180.)
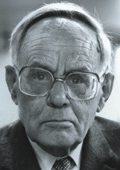
Karl Rahner war ein Mann des Dialogs und liebte das Gespräch
über alles. "Wer Karl Rahner kennt, weiß, daß er im Gespräch aufblüht." Deshalb
besaß er auch zu den Salzburger Hochschulwochen und mehreren Akademien, z.B. den
katholischen in Freiburg und München oder zur evangelischen in Tutzing, eine
gewisse Affinität. Nie hat er auf eine Anfrage zur Mitwirkung bei einer Tagung
eine ausweichende Antwort gegeben. Eine Einladung war ihm oftmals sogar ein
willkommener Anlaß, sich aus einer neuen und unvermuteten Perspektive mit einem
Problem zu befassen. "Wie sehr die Akademievorträge auch das Gesamtwerk Karl
Rahners mitgeprägt haben, zeigt die Fülle der Publikationen, die aus diesen
Beiträgen hervorgegangen und weithin auch in die "Schriften zur Theologie"
aufgenommen worden sind."
Ein kleines unscheinbares Steinchen in Rahners gewaltigem akademischen
Lebensmosaik war die Ottobeurer Studienwoche, zu deren Gründungsmitgliedern er
gehörte. Ottobeuren kann als eines der kleineren Foren gelten, auf dem er "durch
seine persönliche Ausstrahlung und das durch ihn verkörperte Programm [...]
bewußtseinsbildend gewirkt hatte." Die Gründung der Ottobeurer Studienwoche 1966
ist untrennbar mit dem Namen Karl Rahners verbunden. Als Karl Rahner 1977
versuchte, Sr. Dr. Corona Bamberg OSB aus der Benediktinerinnenabtei Herstelle
als Referentin für die Ottobeurer Studienwoche 1979 zu gewinnen, schrieb sie am
16. Dezember 1977 an den damaligen Leiter, P. Aegidius Kolb OSB:
"Herr P. Rahner hat mich im Namen des wissenschaftlichen Gremiums der Ottobeurer
Studienwochen ersucht, 1979 ein Referat zu übernehmen. An und für sich würde ich
das gern tun, nicht zuletzt auch darum, weil ich mich mit Ottobeuren nach wie
vor verbunden fühle. Es stehen aber bereits einige Termine bzw. Anfragen an, so
daß ich gut überlegen muß, was mir möglich ist und was nicht. Vor allem müßte
ich zunächst einmal etwas über Art und Stellenwert der Ottobeurer Studienwochen
erfahren. Vielleicht sind Sie jetzt sehr erstaunt; aber ich konnte bei meinen
Befragungen und auch beim Nachsehen in den einschlägigen Zeitschriften keinen
Hinweis darauf finden. So wäre meine Bitte heute an Sie, mir doch ein paar Daten
zur Orientierung zukommen zu lassen."
§1. Die Ottobeurer Studienwoche wird ins Leben gerufen
Seit ihrer Gründung im Jahre 764 n. Chr. verstand sich die Benediktinerabtei St.
Alexander und Theodor zu Ottobeuren über alle Jahrhunderte hinweg als ein
munimentum religioni, als ein Bollwerk des Glaubens. In den Jubeljahren 1764-66
sah sich der Konvent in der glücklichen Lage, sich zur Tausendjahrfeier des
Klosters selbst zu beschenken: Die Jubiläumsgabe war die neue barocke Kirche als
Siegel auf die tausendjährige Vergangenheit und als Auftakt für die Zukunft. Als
man auch 1964 in zahlreichen Veranstaltungen der Gründung des Klosters gedachte,
unterstrichen viele Festredner das Wissen um die Wirkungskraft der Geschichte in
der Gegenwart und würdigten ausnahmslos die 1200jährige Kontinuität in
Ottobeuren. Doch Jubiläen bergen eine gewisse Gefahr in sich: "Der Blick wendet
sich in die gute alte Zeit zurück. Es ist die Zeit der Jubiläen. Nach den
Visionen fängt dann die Verbindlichkeit der Gemeinschaft an zu schwinden."
Um dem Schwund der Verbindlichkeit in Ottobeuren aktiv zu begegnen, beschenkte
sich der Konvent erneut. Auch das Jubeljahr 1964 kennt eine Jubiläumsgabe: die
Ottobeurer Studienwoche: "Die Jubiläumsfeiern im Jahre 1964 und die erste
Studienwoche waren in der zeitlichen Abfolge kaum ein Zufall, sondern eher ein
Teil einer inneren Entwicklung; der Glanz verlangte, dass man ihn mit Leben
erfülle." Anläßlich eines Dies Academicus am 5. Juli 1964 forderte der Referent
der Hochschulabteilung im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und
Kultus, Ministerialrat Dr. Franz Treppesch, im Kaisersaal der Abtei die
Benediktiner allgemein auf, für die akademische Jugend intensiver tätig zu
werden: "Die Benediktiner, die ein so reiches Erbe verwalten, sollten an dieser
Stätte Hochschulwochen abhalten. Tradition wird museal, wenn sie nur um ihrer
selbst willen da ist; Tradition hat soviel Wert, als sie in die Gegenwart und
Zukunft hereinwirkt. So käme es zu einer Begegnung von benediktinischem Geist
und benediktinischer Welt mit der akademischen Jugend, zum Segen und zum Frieden
der Welt und es würde mitgewirkt, daß dieses ora et labora wieder jene Synthese
findet, in der die Welt heil werden kann." Aus diesen Worten kommt deutlich zum
Ausdruck, wie sehr sich Dr. Franz Treppesch, der seit 1962 (-1969) Mitglied der
Direktoriums der Salzburger Hochschulwochen war, mit der ihm eigenen inneren
Leidenschaft völlig der Sorge um die Studenten verschrieben hatte.
Genau eine Woche nach dem Dies Academicus, am Alexanderfest, fand ebenfalls im
Kaisersaal in Gegenwart von Abtprimas Dr. Benno Gut OSB und Prof. Dr. Augustin
Mayer OSB, dem Rektor von S. Anselmo in Rom, eine Festversammlung der
Bayerischen Benediktinerakademie [BBA] statt. Der Ottobeurer Stiftsarchivar und
Verantwortliche für die Jubiläumsfeierlichkeiten, Pater Aegidius Kolb OSB, regte
hierbei die Möglichkeit an, daß doch die BBA als Basis einer Studienwoche in
Ottobeuren tätig werden könnte. Diese lehnte jedoch auf ihrer Vollversammlung am
30. Oktober 1964 mit dem Hinweis ab, solch öffentliche Tätigkeit entspreche
nicht der Aufgabe und dem Wesen der BBA. Trotz allem hielt Pater Aegidius Kolb
OSB an der Idee von Studienwochen fest und fand im März 1965 in Herrn
Regierungsbaumeister Willy Hornung einen wichtigen und tatkräftigen Mitstreiter.
Die Ergebnisse ihrer Gespräche trugen sie sogleich dem Ottobeurer Abt Vitalis
Maier OSB (*1912, Abt 1948, +1986), vor, der sich begeistern ließ und P.
Aegidius nur kurze Zeit später beauftragte, die Vorarbeiten und Planungen
weiterzutreiben.
Nachdem P. Aegidius am 18. Juni 1965 seinen Freund Prälat Prof. Dr. Johannes
Duft, den St. Galler Stiftsbibliothekar, zur Mitarbeit gewinnen konnte, entstand
ein erster Vorentwurf für die Ottobeurer Studienwochen: "In Fortführung der
1200-Jahr-Feier der Abtei Ottobeuren bietet sich die Aufgabe an, weiterhin eine
Basis geistig-kultureller Wirksamkeit zu sein. Um der akademischen Jugend, die
guten Willens ist, neben dem einseitigen Fachstudium auch die Möglichkeit einer
religiös-weltanschaulichen Orientierung zu bieten, ist Ottobeuren der ideale
Rahmen einer akademischen Studienwoche." Die Initiatoren wünschten sich, daß im
Mittelpunkt dieser Studienwochen immer aktuelle Aspekte stehen sollten, die sich
aus dem Spannungsverhältnis zwischen Glaube, Christentum und Kirche einerseits,
sowie Welt und pluralistischer Gesellschaft andererseits ergeben. Deshalb wurde
als Motto für die Studienwoche der programmatische Satz aus dem Evangelium nach
Johannes gewählt: Spiritus est, qui vivificat (6,63). Neben der ungewissen
Finanzierung bestand eine weitere hohe Hürde bei der Gründung der Studienwoche,
nämlich ein Gremium qualifizierter Wissenschaftler zu bestellen, das die
alljährlichen Studienwochen thematisch vorbereitet. Am 4. Juli 1965 bat P.
Aegidius seinen Freund Johannes Duft, Karl Rahner, Romano Guardinis Nachfolger
auf dem Lehrstuhl für Christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie in
München, anzuschreiben und ihn für das wissenschaftliche Gremium der
Studienwoche zu gewinnen. Schon am 30. Juli 1965 kam der Antwortbrief von
Johannes Duft an P. Aegidius, in dem er ausführlich die Antwort von Karl Rahners
Assistenten Dr. Karl Lehmann, den heutigen Kardinal, zitiert:
"Prof. Rahner ist im Augenblick verhindert und dankt Ihnen vorläufig einmal für
die Unterlagen der "Ottobeurer Studienwoche". [...] Prof. Rahner möchte noch
weitere Einzelheiten der Grundausrichtung einer solchen Studienwoche besprechen,
weil er vor allem aus einer solchen Studienwoche eine eigenständige Sache
erwachsen lassen möchte, die nicht einfach das Vorbild der katholischen
Akademien, der Salzburger Hochschulwochen u.a. kopiert. In diesem Sinne werden
wohl noch einige Gespräche nötig sein. Grundsätzlich aber ist Prof. Rahner zu
einer Mitarbeit im "wissenschaftlichen Gremium" bereit."
§2. Karl Rahners Bereitschaft zur Mitarbeit im wissenschaftl. Gremium
Die Bereitschaft Karl Rahners zur Mitwirkung im Gremium der Studienwoche mag in
Anbetracht seines damaligen Arbeitspensums etwas verwundern: "Das Grundwort
(nicht bloß) dieser Jahre hieß gewiß: Arbeit. Dies weniger als Forschung
verstanden, auch nicht im Sinn einer prinzipiellen Überprüfung und Durchklärung
der eigenen Position (etwa aufgrund prinzipieller Anfragen daran), auch nicht
eigentlich als "Lehre" (obwohl Rahner sich gern einen "Schulmeister" nannte),
das klingt noch zu "systematisch", theoretisch und fertig, sondern besser:
"Auskunft". Auskunft und Antwort auf grundsätzliche Zeitfragen in den
Lehrveranstaltungen und Handbuchbeiträgen; Antwort auf die unterschiedlichsten
Anfragen in den übernommenen Vorträgen vor wiederum ganz verschiedenen
Hörerkreisen, zu denen er im Auto oder Flugzeug auf dem Weg war."
Eine Ahnung von Rahners Arbeitspensum läßt sich dadurch gewinnen, wenn man am
Ende eines jeden Bandes der "Schriften zur Theologie" die Nachweise der Vorträge
und Erstveröffentlichungen liest: "Z.B. fielen allein in die Zeit zwischen Mitte
Oktober und 20. Dezember 1969 fünfzehn solcher Vortragsverpflichtungen, für die
in der Regel auf Wunsch der Veranstalter eigene Vorträge vorbereitet wurden. Die
Bibliographie Rahners weist für die vier Jahre von 1967 bis 1971 allein rund
tausend Nummern aus, ein weiteres Beispiel für seine gewaltige anhaltende
Arbeitsleistung."
Auf der anderen Seite lag Karl Rahner aber gerade der Dialog im
Spannungsverhältnis zwischen Glaube, Christentum und Kirche einerseits, sowie
Welt und pluralistischer Gesellschaft andererseits außerordentlich am Herzen:
"Denn die Christen der Kirche müssen sich untereinander helfen, mit dem
Pluralismus geistiger Wirklichkeiten, der in jedem einzelnen heute unintegriert
gegeben ist, christlich fertig zu werden. Die Christen müssen sich gegenseitig
helfen, die Gefahren für die Reinheit und Wirkkraft (beides!) ihres Glaubens zu
überwinden, die mit diesem Pluralismus gegeben sind." Der Dialog ist in den
Augen Karl Rahners notwendig, "wegen der Situation des pluralistischen Geistes
innerhalb der Kirche." Dieses für ihn äußerst wichtige Thema "Über den Dialog in
der pluralistischen Gesellschaft" griff Rahner auch am 26. Juni 1965 bei der
Feier zur Verleihung des Reuchlin-Preises der Stadt Pforzheim an ihn in seiner
Dankesrede auf. Zwei Wochen später erfolgte die Anfrage zur Mitarbeit im Gremium
der Studienwoche durch Prof. Johannes Duft. Aus diesem Grund ist die Zusage Karl
Rahners nicht verwunderlich, sondern nur konsequent.
Die Vorbereitungen zur Gründungssitzung der Studienwoche liefen gut. Nachdem
einige weitere Wunschkandidaten zwischen Juli und Dezember angeschrieben und
eingeladen wurden, traf sich das neue wissenschaftliche Gremium der Studienwoche
zur Gründungssitzung am 18./19.XII.1965 in München. Neben Karl Rahner waren dies
weitere sieben Universitätsprofessoren, die Initiatoren: Dr. Franz Treppesch, P.
Aegidius , Willy Hornung und Abt Vitalis sowie als geistlicher Begleiter für die
Studienwoche Abt-Koadjutor Dr. Odilo Lechner OSB von St. Bonifaz in München.
Verhindert, aber zur Mitarbeit im Gremium grundsätzlich bereit waren fünf
weitere Professoren.
Die Gründungssitzung fiel in eine für Karl Rahner sehr dichte Zeit. Am 8.
Dezember 1965 schloß die IV. Sitzungsperiode des Konzils, am 12. Dezember hielt
er beim Festakt zum Abschluß des II. Vatikanischen Konzils im Herkulessaal der
Münchner Residenz den großen Festvortrag: Das Konzil - ein neuer Beginn. Kein
Wunder also, daß auch das Generalthema für die erste Ottobeurer Studienwoche
1966 die Handschrift Karl Rahners trägt: Kirche und pluralistische Gesellschaft.
§3. Karl Rahner eröffnet die erste Ottobeurer Studienwoche 1966
Karl Rahner erklärte sich sofort bereit, die Eröffnungsvorlesung zum Thema
Selbstverständnis der katholischen Kirche vorzutragen. Die anderen Themen wurden
zwar vom wissenschaftlichen Gremium inhaltlich abgesteckt, doch man benannte
noch keine dafür in Frage kommenden Referenten. Die Einladung geeigneter
Referenten übernahm eine kleine Gruppe, die sich am 29. Januar 1966 traf. Nach
der Terminabsprache mit Prof. Franz-Martin Schmölz OP schrieb Ministerialrat Dr.
Treppesch am 24. Januar 1966 an P. Aegidius: "Ich würde doch empfehlen, wir
setzen uns Samstag, den 29.I. vormittags mit Schmölz und Lehmann in meinem
Geschäftszimmer im Ministerium zusammen und besprechen die Redner durch." Am
Ende konnten der Sozialphilosoph Prof. Dr. Heinz-Robert Schlette (Bonn):
Christen und Nichtchristen in heutiger Gesellschaft; der Politologe Prof. Dr.
Hans Maier (München): Verhältnis der Kirche zum Staat; und der Staatsrechtler
Prof. Dr. Ernst Wolfgang Böckenförde (Heidelberg): Religionsfreiheit als
Referenten gewonnen werden. Die Vorträge fanden unter Leitung von Prof. Dr. Max
Roesle OSB (Salzburg) vom 26.-29. Juli 1966 im barocken Bibliothekssaal der
Abtei statt. Insgesamt nahmen 38 Studenten und 10 Akademiker aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz teil: Ein großer Erfolg für die erste Studienwoche;
der barocke Glanz Ottobeurens wurde mit neuem Leben erfüllt.
Karl Rahners Eröffnungsvorlesung "Selbstverständnis der katholischen Kirche" am
26. Juli 1966 ist in seinen "Schriften zur Theologie" VIII unter dem Titel "Das
neue Bild der Kirche" (S. 329-354) abgedruckt. Darin stellt er die dogmatische
Konstitution über die Kirche "Lumen gentium" vor, die das II. Vatikanische
Konzil am 21. November 1964 feierlich verkündet hatte. Rahner weist einleitend
auf die Besonderheit des II. Vaticanums hin, daß dieses Konzil nämlich, wie es
bisher bei keinem anderen Konzil der Fall war, ein Konzil der Kirche über die
Kirche gewesen sei, ja, "daß in diesem Konzil die Kirche nicht nur das Subjekt,
sondern auch das Objekt der konziliaren Aussage war, daß dieses Konzil das
Konzil der Reflexion der Kirche auf ihr eigenes Selbstverständnis war."
Wie sieht sich die Kirche selbst? Rahner fragt nach den neuen Zügen im Bild der
Kirche. Neu bedeutet jedoch nicht, wie er hervorhebt, in der Geschichte der
Kirche oder der Theologie bisher Nichtgesagtes zu sagen, sondern sich an das
Ursprünglichste zurückbinden. Damit ist das Älteste immer das Neueste: "Dieses
Älteste und Neueste an der Kirche ist das, was sie sagt und vermittelt. Sie sagt
aber imgrunde nicht sich selbst, sie ist das Wort, das von anderem spricht und
dieses andere für uns gegenwärtig und wirksam setzt." (352) Verstand sich die
Kirche vor dem Konzil zunächst ausschließlich als "Gesamt-, Weltkirche, als
Einheit aller Gläubigen in dem päpstlich-episkopalen Verband" (333), so kam
während des Konzils ein neuer, wichtiger Aspekt hinzu: "Man wollte die konkrete
Kirche des alltäglichen Lebens da sehen, wo sie den Tod des Herrn feiert, das
Brot des Wortes Gottes bricht, betet, liebt, und das Kreuz des Daseins trägt, wo
ihre Realität wirklich eindeutig und greifbar mehr ist als eine abstrakte
Ideologie oder eine dogmatische These oder eine gesellschaftliche
Großorganisation." (335) Wo aber wird dann die Kirche sichtbar oder erfahrbar,
wenn sie nicht mehr nur eine übernatürliche Institution ist? "Die Kirche wird da
nämlich als gegenwärtig begegnen, wo die Gegenwart Christi in der legitimen
Predigt seines Evangeliums und in der Anamnese seines Todes im Abendmahl
realisiert und erfahren wird. Hier wird das religiös und theologisch
urgründlichste und unmittelbarste Kirchenerlebnis seinen Platz haben. Hier wird
der Christ von morgen begreifen, was Kirche eigentlich ist." (336)
Prägnant und klar umschreibt Karl Rahner noch einmal das neue, d.h. um
Ursprünglichkeit ringende Selbstverständnis der Kirche auf dem II. Vatikanischen
Konzil: "Die Kirche versteht sich selbst am besten, wenn sie sich vollzieht, das
heißt aber, wenn sie von Gott und seiner Gnade, von Jesus Christus, seinem Kreuz
und seiner Auferstehung und von dem ewigen Leben spricht und sich in diesem
Wort, das sie spricht, von der Gnade Gottes ergreifen läßt. Wir können auch
sagen: Sie begreift erst, was sie als Heils-"anstalt" ist, wenn sie sich selbst
als Heilsfrucht versteht und vollzieht. Kein Zweifel, daß die
Kirchenkonstitution diese Wende vollzogen hat. Sie spricht zwar ausführlich -
warum auch nicht? - von der Kirche als Institution, von ihren Ämtern und
Vollmachten, also von der Kirche als Heilsanstalt und Heilsvermittlung. Aber das
alles ist doch eingefaßt und unterfangen durch ein grundlegenderes
Kirchenverständnis, das die Kirche als das von Gottes Gnade zusammengeführte
Volk Gottes sieht und die Kirche als Ergebnis der Gnade Gottes, als Heilsfrucht
versteht." (352).
Im neuen Selbstverständnis der Kirche liegt nach Karl Rahner die notwendige
Öffnung der Kirche nach innen zu ihren eigenen Kritikern, sowie nach außen zur
Welt und deren pluralistischer Gesellschaft. Öffnung bedeutet jedoch nicht
Preisgabe des Wesens. Hat die Kirche nämlich nicht den Mut, sich von der Welt
dennoch zu unterscheiden und Profil zu zeigen, dann wird sie aufhören, Kirche zu
sein.
Karl Rahners Eröffnungsvortrag hinterließ einen bleibenden Eindruck unter den
fast 50 Zuhörern. Viele Jahre danach schrieb Abt Vitalis Maier OSB Karl Rahner
zum Namenstag: "Man hat in Ottobeuren nie vergessen, mit welchem Elan Sie bei
der Gründung der Ottobeurer Studienwoche dabei waren - und auch den ersten
Vortrag 1966 übernommen haben. Es war der Dienstag, der 26. Juli, als Sie das
Thema "Kirche und pluralistische Gesellschaft" mit ihrem Beitrag: "Das
Selbstverständnis der Katholischen Kirche" in Ihrer gekonnten Art mit liebender
Weisheit und kritischer Brisanz in unserer Bibliothek vor dem interessierten
Publikum eingeleitet haben. Sie haben also die Freude und Genugtuung, daß sie
die Ottobeurer Studienwoche eröffnet und auf den Weg gebracht haben.?
An einen "ganz anderen" Karl Rahner auf der ersten Studienwoche erinnerte sich
einer der Zuhörer 25 Jahre später zurück: "So ist auch ein persönlicher Kontakt
möglich, sei es bei den gemeinsamen Mahlzeiten oder abends im Wirtshaus. Aus
solcher Nähe werden dann auch professorale Vorlieben und Marotten sichtbar: Karl
Rahner musste, hohe Theologie hin oder her, am Fernsehen die Fussballspiele der
Weltmeisterschafts-Endrunde sehen. Hans Maier hatte den Mut, uns ausserhalb
rechtlicher Ueberlegungen über Kirche und Staat ein Orgelkonzert darzubieten."
Den Mitgliedern des wissenschaftlichen Gremiums konnte also auf der zweiten
Gremiumssitzung am 17./18. Dezember 1966 von einem guten Anfang berichtet
werden, der zu vielversprechenden Hoffnungen für die Zukunft Anlaß gab. Karl
Rahner, der die Gründung der Studienwoche bislang tatkräftig unterstützt hatte,
wurde kurz nach dieser Gremiumssitzung zum 1. April 1967 nach Münster auf den
Lehrstuhl für Dogmatik/Dogmengeschichte berufen. Durch die räumliche Entfernung
zwischen Münster und München war es ihm zwar nicht mehr so leicht möglich, an
den Gremiumssitzugen der folgenden Jahre teilzunehmen, doch aus dem Gremium
wieder ausscheiden wollte Karl Rahner unter keinen Umständen. Erst 1971, als er
in Münster emeritiert wurde und wieder nach München zurückkehrte, war an eine
erneute Mitarbeit im Gremium zu denken. An der Sitzung vom 1. Dez. 1973 in St.
Bonifaz nahm er teil und erklärte sich kurze Zeit später in einem Brief vom 22.
Jan. 1974 bereit, die Schlußvorlesung der Studienwoche 1974 zu übernehmen.
§4. Karl Rahners "Ottobeurer Testament" auf der Studienwoche 1974
Das Generalthema 1974 lautete: Frieden und Christentum. Prof. DDr. Eugen Biser
(Würzburg), der designierte Nachfolger Karl Rahners auf dem Münchner
Guardini-Lehrstuhl für Christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie,
eröffnete die Studienwoche am 6. August 1974 mit dem Thema: Der Friedensauftrag
des Christentums. Umrisse einer Theologie des Friedens: Die Friedensbotschaft
Jesu. Ihm folgten Prof. Dr. Otto Kimminich (Regensburg): Christentum,
Völkerrecht und europäische Friedensforschung und Prof. Dr. Hans Zwiefelhofer SJ
(München): Befreiung durch Revolution oder gewaltlosen Widerstand?
Karl Rahner sprach abschließend 1974 zum Thema: Konflikte in der Kirche. Diesen
Vortrag hat er vermutlich unter dem Titel Opposition in der Kirche publiziert.
Zwei Indizien sprechen dafür: a) Der Bericht in der ?Memminger Zeitung? vom 13.
August 1974 schildert nicht nur die Grundgedanken von Rahners Aufsatz, er
referiert auch dieselben Beispiele bis hin zu identischen Formulierungen. b)
Rahner hielt diesen Ottobeurer Vortrag im August, unmittelbar darauf erschien er
im November/Dezember-Heft der Zeitschrift Stimmen der Zeit 192 (1974), 812-820.
Karl Rahner feierte 1974 seinen 70. Geburtstag und war wohl der bedeutendste
lebende deutschsprachige Theologe seiner Zeit. In den USA erhielt er 1974 drei
Ehrendoktorate, am 10. Juli 1974 wurde er Corresponding Fellow of the British
Academy, am 15. Juli erhielt er die Lorenz-Werthmann-Medaille des Deutschen
Caritas-Verbandes. Am 9. August sprach er in Ottobeuren. Der Vortragssaal, die
Barockbibliothek der Abtei, mußte wegen Überfüllung vorzeitig gesperrt werden.
Als Karl Rahner über Konflikte in der Kirche sprach, wußte er nur zu genau, von
was er redete. Als Konzilstheologe erlebte er hautnah das Ringen der Kirche um
die Deutung der Zeichen der Zeit. Im Juni 1970 wurde Rahner zum Synodalen der
Würzburger Synode gewählt. "Weniger in Wortmeldungen als mehr am Rande der
Synode hat er Synodale in vielen Tag- und langen Abendgesprächen zu einem klaren
Sachbeitrag ermutigt und so zur offenen Gesamtatmosphäre der Synode beigetragen.
Wenn er selbst das Wort ergriff, so war es an entscheidenden Stellen, um
drohende Engführungen meist theologischer Art zu vermeiden und das Feld nach
vorne offenzuhalten."
Konflikte entstehen durch Meinungsverschiedenheiten. Kritik und Opposition
gehören unabdingbar zum menschlichen Leben. Weil die Kirche die Gemeinschaft
gläubiger Menschen ist, muß als erstes gesagt werden, "daß es in der Kirche
Opposition und Kritik grundsätzlich, und zwar als inneres Moment der vollen und
glaubensmäßigen Kirchlichkeit selbst, geben kann und geben soll." (471)
Abgesehen von ihrem Grundwesen ist die Kirche ständigem Wandel unterzogen, ihre
Gestalt verändert sich permanent und ist deshalb durchaus kritisierbar. Zum
Wesen eines mündigen Christen gehört seine Kritikfähigkeit, "vorausgesetzt, daß
der Opponent an einem positiven Verhältnis zur Kirche grundsätzlich festhält."
(469) Kritik und Gegenkritik im eigentlichen Sinne zeugen deshalb für kirchliche
Lebendigkeit. Sie sind "oft langwierige und bitter empfundene Prozesse auf allen
Seiten. Sie müssen mit gegenseitiger Toleranz, Geduld und Hoffnung
durchgestanden werden, in einem eindeutigen Bekenntnis aller zu dem einen und
bleibenden Glauben der Christenheit an Gott in Jesus Christus." (474) Rahner
forderte in der sich anschließenden Diskussion nicht nur die Bischöfe, sondern
alle Gläubigen auf, sich mehr Konfliktfähigkeit zuzutrauen und Konflikte nicht
als störende Betriebsunfälle zu betrachten. Dieser Appell untersteicht, daß jede
um die Wahrheit ringende Kritik ein zentrales "inneres Moment der vollen und
glaubensmäßigen Kirchlichkeit selber" (471) ist. Hier spricht deutlich Rahners
eigenes Wesen: "Seine Botschaft war klar: das Trennende nicht ignorieren, jedoch
das Gemeinsame, Einigende als die große Aufgabe zu sehen."
Trotz seiner lebhaften Ausführungen wirkte der 70jährige Karl Rahner auf seine
Zuhörer müde und abgespannt. Deshalb wurde sein Appell in der Memminger Zeitung
überschrieben mit: Prof. Rahners Ottobeurer Testament. Doch der Eindruck
täuschte gewaltig. Karl Rahner waren noch zehn wichtige Lebensjahre geschenkt.
§5. Die OStW in Karl Rahners letztem Lebensjahrzehnt
1974 und 1975 konnte Rahner an den Gremiumssitzungen nicht teilnehmen, weil er
auf der Synode in Würzburg gebraucht wurde. Doch in den Jahren 1976, 1977, 1979
und - zum letztenmal - 1980 war er anwesend. "Die Lebens- und Arbeitsumstände in
München waren für den alten Rahner nicht erfreulich. Es zog ihn immer mächtiger
zurück in das Jesuitenhaus, in dem er seine arbeitsreichste und dramatischste
Zeit verlebt hatte, nach Innsbruck." Am 19. November 1981 zog er um. Auf seine
Einladung zur Gremiumssitzung erhielt P. Aegidius Kolb OSB von Karl Rahner am 5.
November 1981 folgende Antwort:
"Lieber Pater Aegidius, leider kann ich zu der Sitzung am 5./6. Dezember 1981
nicht kommen. Ich ziehe nämlich in 14 Tagen von München nach Innsbruck (Sillgasse
6) um. Bei dieser Situation ist es mir beim besten Willen nicht möglich, am 6.
Dezember schon wieder in München zu sein, weil in den nächsten Wochen mit diesem
Umzug so viel Scherereien verbunden sein werden." Obwohl Karl Rahner bis zu
seinem 80. Geburtstag am 5. März 1984 in vielen Städten noch zahlreiche Vorträge
hielt, führte ihn sein Weg nicht mehr nach Ottobeuren. Überblickt man die Jahre
1965 bis 1984, so besteht in Ottobeuren Karl Rahner gegenüber ein tiefes Gefühl
der Dankbarkeit. Dennoch ist dieser Beitrag nicht als Laudatio auf Karl Rahner
gedacht, damit wüßte er nichts anzufangen: "Man wird bei solcher Lektüre rot und
denkt sich: So bin ich nicht, würde aber gerne so sein."